Posted: November 6th, 2006 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: Boris Dlugosch, Front, Groove, Klaus Stockhausen, Phillip Clarke, Willi Prange | 9 Comments »

„I can’t even dance straight.” (Aufdruck eines Front-Tshirts)
Das gängige Club-Koordinatensystem in Hamburg Mitte der 80er bewegte sich irgendwo zwischen Mod-Kultur und Northern Soul sowie Post-Punk und Wave in Läden wie dem Kir und Disco-Poppertum im Trinity, Voilà oder Stairways. Welcher Hafen angelaufen wurde, entschied sich meistens danach, ob der Schwerpunkt der Planung auf Musik bzw. Tanzen, Mädchen oder Saufen gelegt werden sollte. Diese Komponenten kamen zwar manchmal auch an einem Ort befriedigend zusammen, aber in der Hansestadt wurde schon immer bei ersten Anzeichen von diesbezüglichen Ungleichgewichten der Standort verlagert. DJs mixten in der Regel nicht und die Musik war oft ziemlich durcheinander und demnach war man es auch gewohnt, nur hier und da zu tanzen und den Rest der Nacht anderweitig auszufüllen.
Etwas ab vom Schuss, Nähe Berliner Tor, gab es dann noch das Front, das Willi Prange 1983 eröffnet hatte. Der Stamm-DJ dort war ab 1984 der Kölner Klaus Stockhausen, der ebenso wie andere DJs in der Stadt eine Mischung aus Boogie, Synthpop, Electro, Hi-Energy und Italo auflegte. Dennoch hatte das Front im Rest der Stadt schnell diesen speziellen Status. Das lag einerseits sicherlich daran, dass das Publikum dem Vernehmen nach fast ausschließlich schwul war und sich nicht groß darum kümmerte, sich jedes Wochenende so abseits von Kiez oder Alster zusammenzufinden. Andererseits lag das aber auch vor allem an Stockhausen, der seinen Kollegen in vielerlei Hinsicht weit voraus war.
Von seinen besonderen Fertigkeiten als DJ erfuhr zuerst ich von einem meiner besten Freunde, der ein klein wenig älter war und schon ab 84 regelmäßig hinfuhr. Dort kaufte er Stockhausen irgendwann einen Schwung Live-Mitschnitte auf Kassette ab, für ganz schön gutes Geld, der Mann wusste eben was er wert war. Als ich die Tapes zum ersten Mal hörte, war ich ziemlich baff. Ich hatte ein langjähriges Faible für alle Arten von tanzbarer Musik, aber was man damit im Mix anstellen konnte war mir eher fremd. Ich erkannte Teile meiner Plattensammlung wieder, aber irgendwie klangen die anders, energetischer und aufregender. Es liefen viele instrumentale Versionen, versetzt mit Soundeffekten, Scratches und Acapellas. Verschiedene Platten liefen minutenlang zusammen, oder Teile davon nur wenige Sekunden. Die meiste Zeit konnte ich die Stücke gar nicht auseinanderhalten. Ich hatte keinen Schimmer, wie man so was hinbekommt. Die Musik-Auswahl war dabei durchweg geschmackssicher und abenteuerlustig zugleich. Live muss das der Hammer sein, dachte ich.
Tatsächlich waren die Nächte im Front zu dieser Zeit schon ziemlich ausgelassen, doch richtig Fahrt kam ab Ende 85 auf, als bei Tractor und später Rocco und Container Records die ersten House-Importe eintrafen. Ich bekam House erst mit, als „Jack Your Body“ und „Love Can’t Turn Around“ 1986 plötzlich Hits wurden, aber es gefiel mir auf Anhieb. Es erschien wie die perfekte Synthese von allen möglichen Club-Stilen, war aber gleichzeitig total primitiv und direkt. Eine verheißungsvolle Variante in der Chronologie von Disco sozusagen. Im Front wurde House nach Ohrenzeugen vom Fleck weg vereinnahmt, es gab zwar nicht viele Platten zu kaufen, aber was verfügbar war, wurde auch gespielt. Die europäische Clublandschaft ist sicherlich zu diffus und weitläufig, um wirklich exakt die historischen Initialzündungen zu benennen, aber wenn man sich mit der entsprechenden Geschichtsschreibung in anderen Ländern befasst, war Hamburg verdammt früh dran, ohne davon viel Aufhebens zu machen. Die regelmäßigen Wochenendgäste aus England schienen sich jedenfalls mit voller Absicht zum Tanzen in die touristisch unterentwickelte Gegend am Heidenkampsweg zu verirren.
Das erste Mal dass ich tatsächlich ein Teil der schrägen Schlange wurde, die sich zeitig vor den Stiegen abwärts sammelte, war Anfang 87. Ich war fast volljährig und etwas angespannt. Die coolen Typen um mich herum schienen es kaum abwarten zu können, von dem mürrischen Kerl mit dem Schnauzbart durchgewunken zu werden, der die Tür zu dem Keller verwaltete. Das Publikum bestand zur stolzen Mehrheit aus schönen Jungs in glammigen Outfits und halbnackt-muskulösen Lederkerls, und es war zahlreich erschienen und schrie sich auf der Tanzfläche bereits geschlossen die Seele aus dem Leib. Der Club an sich war absolut unglamourös. Karg war noch untertrieben. Die Wände waren nackt bis auf ein paar Notausgangschilder, auf denen ab und zu „Danger“ aufblinkte und gelegentliche Diaprojektionen mit Worthülsen wie „I mean…is he…“ oder „…and suddenly…“. Die Tanzfläche war gesäumt von niedrigen Podesten mit Geländer, die einen bei der niedrigen Decke noch näher an die fiesen Horn-Hochtöner brachten, Bestandteile einer Anlage, die nicht unbedingt gut war, aber sehr effektiv und vor allem sehr laut.
Die Lightshow bestand lediglich aus verschiedenfarbigen Neonröhren, die sich über der ganzen Tanzfläche erstreckten und in unnachvollziehbaren Intervallen ins Dunkel blitzten. Und im Gegensatz zu anderen Hamburger Clubs war es sehr dunkel, gepaart mit einem ungemein stickigen Dunst von mehr oder weniger nackten Körpern und Poppers, der stetig von der Decke tropfte und als dichter Nebelschwall über die Belüftung direkt neben den Eingang wieder auf die Straße zurückgeleitet wurde, als sollte er wie der Rauch bei der Papstfindung der Außenwelt künden, was für eine Stufe des Exzesses dieses Wochenende gemeinsam erreicht wurde.
Man kam eher zum Tanzen als zum Posen ins Front, auch wenn man bei Bedarf beides gleichzeitig konnte, und ließ sich von der wummernden Pracht von links nach rechts schicken. Die Stimmung war physisch und bis zum Anschlag sexuell aufgeladen. Die Front Kids hatten ihren Tempel eingerichtet und huldigten dem Hedonismus mit bedingungsloser Loyalität. Alles war egal, solange es Spaß machte. Wenn man sich überhaupt von der Tanzfläche entfernen wollte, waren die einzigen Ablenkungen eine Theke mit ein paar Bänken ein Gewölbe tiefer, deren Zapfanlage unter Gejohle von mitfeiernden Barleuten zum Beat bearbeitet wurden, die nicht selten im Torerokostüm den Dienst antraten, ferner notorische Toiletten mit äußerst regem Verkehr und deaktivierter Geschlechtertrennung sowie ein Flipper, der nie funktionierte.
Der ganze Überschwang hatte souveräne Methode, die von einem DJ-Bereich gesteuert wurde, der sich in einem wesentlichen Punkt von anderen unterschied; man konnte den DJ nicht sehen. Die Kanzel war eine erhöhte dunkle Box, die von der Tanzfläche aus durch eine Tür zugänglich war, der DJ schaute durch zwei winzige Schießscharten heraus und war selbst nur schemenhaft zu erkennen. Das hatte durchaus den Effekt, dass man sich auf die Musik konzentrierte bzw. dass die Musik teilweise wie aus einer anderen Welt herübergesendet kam, obwohl man sich natürlich sehr wohl bewusst war, dass der zuständige Zeremonienmeister etwas Besonderes war, was denn auch mit viel Geschrei auf dem Floor honoriert wurde.
Eine konsequente Absage an die fortschreitende Personifizierung des DJs, aufgrund derer Stockhausen schließlich 91 für immer die Kopfhörer für eine ebenso erfolgreiche Karriere als Moderedakteur bekannter Lifestylemagazine niederlegte. Wie er aussah wusste ich erst Jahre später dank einer Fotostrecke in einem Stadtmagazin, es war auch nicht wichtig. Gleiches galt auch für seinen überaus talentierten Nachfolger Boris Dlugosch, der ab 1986 Stockhausens Protegé war und nach dessen Rückzug den Taktstock übernahm und ebenso stilprägend die nächste Ära des Clubs dirigierte und weitere DJs wie Michael Braune, Michi Lange, Sören Schnakenberg und Merve Japes. Promis wurden vermehrt gesichtet, aber kaum beachtet. Diese Rahmenbedingungen sollten sich für die nächsten Jahre nur unwesentlich ändern. Es gab Rituale wie den Laster von einer Quadrophonie-Testplatte, der bei gelöschtem Licht durch den Raum knatterte und meistens die Schlussphase mit einem Rückblick auf Disco-Klassiker einläutete, die allerdings auf dem Front-Soundsystem klangen, als wären sie in einem Kugelblitz wiedergeboren worden. Es gab diverse zügellose und Spezialveranstaltungen mit wechselndem Motto und den jährlichen Geburtstagsrausch, bei dem immer noch eine Schippe draufgelegt wurde. Unvergessen dabei der Auftritt eines unbescholtenen Straßenmusikers, der anlässlich des ersten Golfkriegsausbruchs von der Einkaufsmeile wegengagiert wurde und dann nervös vor dem ekstatischen Auditorium „Give Peace A Chance“ klampfte.
Bei der Entwicklung von House und allen daraus resultierenden Stilarten war das Front in den folgenden Jahren eine unerbittliche Messlatte. Zuerst kam die Acid-Phase, die auch über andere Neueröffnungen wie das Opera House, Shag oder das Shangri-La die ganze Stadt eroberte, und Detroit Techno wurde in der ersten Welle herzlich umarmt. Ausflüge in Clubs anderer Städte zu dieser Zeit vermochten im Vergleich nicht so recht zu überzeugen, man freute sich bereits auf das nächste Heimspiel. Ab 89 kamen die New Yorker Hybriden aus Techno und House der Marke Nu Groove und Strictly Rhythm dazu, und man verneigte sich gelegentlich vor den Post-Acid-Entwicklungen der Insel, Bleeps etwa, oder Shut Up And Dance und 4 Hero, damals noch Breakbeat Techno genannt.
Als Techno sich ab 91 mehr und mehr über Härte definierte, besann man sich im Front jedoch auf die hauseigene Tradition des Groove und überließ das Geheize Läden wie dem ersten Unit. Die Anteile von Garage und Deep House wurden unter der Ägide von Dlugosch quasi über Nacht nach vorne gemischt, ohne dass die unbeschwerte Dynamik auf dem Floor Einbußen erlitt, der Rausch klang nur etwas anders. Das Front verband Schub mit Stil und hatte seine Jünger bestens mit House erzogen und so wurde aus Hamburg, im Vergleich zu anderen Metropolen, nie eine Technostadt.
Der Club wurde in der Face, im I-D und in der Tempo als Weltklasse bestaunt und war auch mit Dlugosch mindestens auf Augenhöhe mit Clubs der reinen Lehre in den USA oder England und in Kontinentaleuropa lange Jahre praktisch konkurrenzlos, was nicht zuletzt dadurch untermauert wurde, dass das Front auch sehr früh begann, die Heldengestalten aus Übersee zu buchen. DJ Pierre versagte Wild Pitch und machte das mit Acid trifft Garage wieder wett, Mike Hitman Wilson versagte einfach völlig, Frankie Knuckles legte ein Handtuch um und eine Flasche Cognac und Tischventilator vor sich und breitete das große Gefühl aus, die Murk Boys waren gegenseitige Liebe auf den ersten Blick und Derrick May wollte gar nicht mehr aufhören.
Diese ersten Gäste vermittelten aber auch Einblicke in andere Szenen, was immer mehr Clubgänger interessierte und die Konkurrenz in der eigenen Stadt nahm zu und bediente sich beim Standard des Front. Die schwule Basis fühlte sich mehr und mehr von Neugierigen bedrängt und die Faces der ersten Generation zogen sich langsam zurück, der Geist der Pionierzeit verlor auch in der Musik an Strahlkraft und selbst die Nachttanke um die Ecke war plötzlich nicht mehr da.
Dennoch empfand ich es wie viele als Privileg, speziell an diesem Ort live zu hören wie sich das Haus erbaute, in dem wir heute noch allesamt wohnen. Nur lief die Chose irgendwann von ganz allein und an anderen Orten und ich ging ab 94 immer sporadischer hin, bis mich dann 97 die Nachricht von der Abschiedsparty wachrüttelte. Ich zog es vor, es in Erinnerung zu behalten wie es zu besten Zeiten war und bin nicht hingegangen. Das Inventar wurde später, einer echten Clublegende angemessen, wie Reliquien meistbietend versteigert.
Das perfekte Souvenir hatte ich aber ohnehin schon, es ziert noch immer meine Zimmertür: das Schild von der Damentoilette, mysteriöserweise eines Sonntagmittags auf meinem T-Shirt klebend, als ich in voller Montur auf dem Fußboden eines Kumpels aufwachte. Gute Zeiten. Klaus Stockhausen ist immer noch der beste DJ, den ich jemals gehört habe und die Intensität des Clubs bleibt für mich selbst minus sentimentaler Verklärung unübertroffen. Es hat mich tief geprägt. Wenn ich von Berlin nach Hamburg hineinfahre werfe ich jedes Mal einen verstohlenen Blick auf das Leder-Schüler-Gebäude und habe Musik im Kopf. This used to be my playground.
Mit besonderem Dank an Walter Fasshauer, Patrick Lazhar und Frank Ilgener.
Groove 11/06
Danke für alles, Willi Prange und Phillip Clarke… R.I.P.

Posted: July 9th, 2006 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: de:bug, Interview, Timmy Regisford | No Comments »
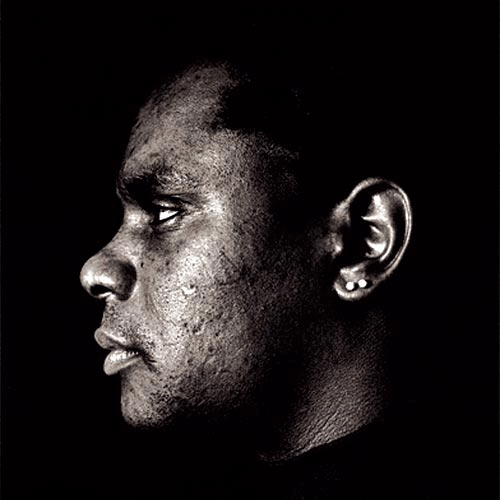
Wie fühlt es sich an, ab und zu den angestammten Platz zu verlassen? Kann man das Shelter verpflanzen?
Ich mag es, gelegentlich New York zu verlassen und woanders aufzulegen. Es gibt weltweit mittlerweile immer mehr Leute, welche die Art von Soulful Music mögen, für die das Shelter steht. Ich habe auch eine Residency in Los Angeles und regelmäßig Auftritte in Japan oder England. Ich habe zudem einen Wohnsitz in Amsterdam, weil ich die Stadt einfach liebe und auf Jamaika, wo ich ursprünglich herkomme. In Deutschland war ich bisher nur einmal mit Stevie Wonder, dass hatte sich sonst einfach nicht ergeben. Ich kann mir aber gut vorstellen, öfter hier zu sein. Mir gefällt die Idee von fixen Außenposten fernab des ursprünglichen Clubs. Das reizt mich als Herausforderung. Es wäre schön, weltweit Basen für den Shelter-Sound einzurichten, daran würde ich mich gerne beteiligen. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Wie unterscheiden sich dann solche internationalen Auftritte von einer Nacht im Shelter? Muss man das musikalische Programm den Trends im jeweiligen Land anpassen?
Ich muss mich eigentlich gar nicht anpassen. Ich werde als Repräsentant des Shelter gebucht und ich spiele nur Platten, die ich auch dort auflege. Ich bekomme mit, was in den Clubs anderswo läuft, aber mir ist das oft zu hart, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich achte auch nicht auf die ganzen Kategorisierungen, für mich ist das alles Dance Music und davon interessiere ich mich nur für die Art von Musik, die Deepness, Soul und vor allem Identität hat. Aus welchem Land oder von welcher Hautfarbe ist egal, es muss nur passen. Manchmal ist ein Set nicht so wie in New York, weil ich nicht soviel Zeit habe. Übermorgen lege ich beim Southport Weekender in England auf, da habe ich einen zweistündigen Spot. Dabei brauche ich meistens drei Stunden, bevor ich mich wohl fühle. Ich werde das daher nutzen, um unveröffentlichte Sachen zu spielen, aber ich ziehe einen anderen Rahmen vor. DJing war nie mein hauptsächlicher Lebensunterhalt. Ich war deswegen auch nicht gezwungen mehr herumzureisen als ich wollte. Das Shelter ist wie mein Wohnzimmer, da ist alles so, wie ich es haben möchte. Alle meine Platten sind da, die Anlage habe ich mir zusammengestellt und so weiter. Und mir gehört der Club, ich kann machen, was ich will. Ich lege hauptsächlich Soulful Dance Music auf, aber ich kann auch afrikanische oder brasilianische Musik spielen, Jazz, Blues. Wenn ich merke, wofür die Leute bereit sind, habe ich viel Spielraum. Das Shelter hat einen familiären Vibe, es geht nicht um Drogen oder Hipness, nur um Musik. So geht das Woche für Woche. Wenn ich mal nicht da bin, so wie jetzt gerade, legt Sting International auf, sozusagen mein Protegé. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Leute mit ihm warm geworden sind, aber jetzt geht das sehr gut. Read the rest of this entry »
Posted: June 9th, 2006 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: de:bug, Haruomi Hosono, Interview, Uwe Schmidt | No Comments »

Was war der Grund, die Musik vom Yellow Magic Orchestra für ein Album von Senor Coconut zu verwenden?
Uwe Schmidt: Meiner Meinung nach sollte es für das Musikmachen eigentlich keine Zielsetzung geben außer dem musikalischen Impuls. Bei allen Senor Coconut Alben war es bis dato auch so, dass die Idee zu einem Album immer aus diesem musikalischen Impuls heraus entstand. Das, was man so den Überbau nennt, kommt interessanterweise für mich immer viel später nach Abschluss der Produktion und fast immer erst durch Reaktionen und Reflektionen von außen. Interpretationen darüber, um was es auf dem Album geht, und wie es funktioniert. Das ist bei “Yellow Fever!” nicht anders. Als es darum ging, das nächste Senor Coconut Album zu machen, ergaben sich diesmal unzählige Möglichkeiten. Sich YMO zu widmen war in der Tat nur eine Idee unter vielen. Die “Yellow Fever!”-Idee entwickelte dann allerdings eine gewisse Eigendynamik, die irgendwann in den musikalischen Impuls überging, d.h. das “sich Vorstellen” der neuen YMO-Versionen im Senor Coconut-Kontext. Von da an sind es musikalische Ideen, keine konzeptuellen-, oder abstrakten Überbauten, die das Projekt ausmachen und leiten. Diese Eigendynamik hat bei eigentlich allen meinen Arbeiten zum einen etwas mit verschiedenen Arten der Annäherung an Musik und musikalische Struktur zu tun als auch zum anderen mit dem Ausprobieren neuer Arbeitsmethoden, welche wiederum mit bestimmten ästhetischen Resultaten zusammenhängen. Wenn man sich die letzten drei Coconut Alben anschaut, dann wird man feststellen, dass jeweils andere Ansätze, inhaltlicher und formeller Natur, bearbeitet wurden. Bei “Yellow Fever!” wollte ich mich ungern wiederholen, was Arbeitsmethode, Form und Struktur des Albums angeht. Daher denke ich auch, das “Yellow Fever!” eine Art Vereinigung formeller Natur der kompletten Schaffensperiode von Senor Coconut darstellt. Von eher abstrakten Cut & Paste-Ansätzen, wie auf dem ersten Album “El Gran Baile” von 1997, über akustische Simulationen bis hin zu deren Zerstörung, wollte ich auf “Yellow Fever!” gerne ein weiteres Spektrum an Formen vertreten sehen. Während der Arbeit an dem Album traten dann neue, unerwartete Referenzen auf, wie z. B. zu Martin Denny und “Exotica”. Beides Referenzen die auf den vorherigen Alben als solche nicht zitiert wurden, dennoch natürlich immer schon vorhanden waren. Wenn man also überhaupt von Zielsetzung sprechen kann, dann war es die, permanent überrascht zu werden und Querverbindungen zeitlicher und räumlicher Natur entdeckt zu haben.
War das als logische Fortsetzung zu der Benutzung von Kraftwerk-Material gedacht oder war das eine Idee, die schon länger da war?
US: Es war, wie bereits erwähnt, eine von vielen Ideen, die lange Zeit im Raum stand. Auf keinen Fall war es eine logische Konsequenz, sondern eine, welche aufgrund von vielen unzähligen Momenten eine Eigendynamik und ein Eigenleben entwickelte, und sich quasi selber aussuchte. Die Nähe zu “El Baile Aleman” liegt nahe, das stimmt. Interessanterweise ist das Resultat ein ganz anderes, was es nicht unbedingt zu einer logischen Fortsetzung werden lässt.
Wie wurde das Material ausgesucht? Orientiert sich die Auswahl an persönlichen Favoriten oder wurde sie dem Konzept angepasst?
US: Es gab diesmal fast schon zu viele Entscheidungspunkte, die die finale Auswahl recht schwer treffen ließen. Zunächst wählte ich die Titel aus, die eine Umsetzung in das Konzept zuließen, wobei es bei YMO leider sehr viele instrumentale Stücke gibt, bei Senor Coconut aber die stimme von Argenis Brito ein sehr wichtiges Element ist. Von den Plattenfirmen wurde mir weiterhin nahe gelegt, doch nicht gerade die unbekanntesten Titel auszusuchen, sondern wenn möglich die originalen Singleauskopplungen mit zu berücksichtigen. Mir war es nun wichtig z. B. nicht nur zu viele schnelle, bzw. langsame Titel auszuwählen, bzw. nicht nur Chachachas oder Mambos etc. Auch wollte ich wenn möglich jeweils drei Titel von jedem YMO-Mitglied bearbeiten und nicht nur Stücke von etwas Sakamoto oder nur Takahashi. Und zu allem Überfluss war mir wichtig, wenn möglich die ganze Schaffensperiode von YMO abzudecken. Aus der Schnittmenge all dieser Auswahlkriterien musste ich dann nur noch die Titel aussuchen, die ich inspirierend fand, was glücklicherweise dann nicht ganz so schwer war.
Wie kam diese Kollaboration zustande? Gab es einen Kontakt über den Atom™-Remix von Sketch Shows “Microtalk” oder geht das weiter zurück?
US: Es gab zum einen den Kontakt zu Haruomi Hosono, der bis in das Jahr 1995 zurückführt. Zusammen mit Tetsu Inoue gab es dann zwei Alben mit Hosono unter dem Projektnamen HAT. Das erste Album erschien 1997 auf Rather Interesting und kurz danach auf Hosonos Label Daisyworld in Japan. 1997 nahmen wir unter HAT dann das zweite Album in Santiago auf, DSP Holiday, welches ebenfalls auf Daisyworld erschien. Zwischen diesen beiden Alben veröffentlichte Daisyworld auch ein Album von Lisa Carbon und es gab mehrere kleinere Lizenzen auf Daisyworld Compilations. Ende 2004 veröffentlichte Daisyworld dann noch das Album “Acid Evolution 1989-2003”, eine Fake-Compilation zur Geschichte von Acid und man bat mich zudem noch den Sketch Show-Titel “Mikrotalk” zu remixen. Kurz: der Kontakt zu Haruomi Hosono und Daisyworld geht schon einige Jahre zurück. Parallel dazu trat vor ca. drei Jahren Ryuichi Sakamoto auf mich zu, und lud mich für sein Chain Music-Projekt ein. Auch hier gab es seit dem einen stetigen Kontakt. Die Idee alle drei YMO-Mitglieder einzuladen gab es von Anfang an, und aufgrund der Tatsache mit zumindest zwei von ihnen in Kontakt zu sein, empfand ich es auch als nicht komplett abwegig, einfach ganz naiv nachzufragen, ob Interesse an einer Teilnahme besteht.
Im Gegensatz zu Kraftwerk bezüglich “El Baile Aleman” sind nun alle Mitglieder von YMO und zahlreiche andere Kollaboratoren vertreten. Wie war diese Beteiligung gedacht und wie hat sie sich ausgewirkt?

Haruomi Hosono: Ich hatte schon früher mal daran gedacht, eine Latin-Version von “Rydeen” zu machen. Jetzt bin ich aber regelrecht froh, dass das nicht zustande kam, so brilliant finde ich dieses Album. Es gab vorher keine Remixe unserer Musik mit einem vergleichbaren Ansatz und ich hatte viel Spaß an der Zusammenarbeit und war auch sehr gespannt auf die Ergebnisse.
US: Neben Sakamoto, Hosono und Takahashi gab es eine lange Liste von anderen Teilnehmern, die ich gerne auf “Yellow Fever!” einladen wollte. Eigentlich nur aus räumlichen Gründen, nämlich dass es schlicht und ergreifend nicht genug platz gab Gastbeiträge unterzubringen, musste ich mich dann aber auf eine reduzierte Auswahl beschränken. Im Laufe der Produktion stellte sich dann schrittweise heraus, wer auf welchem Song was machen könnte und was nicht. Das gilt sowohl für die drei Original-Mitglieder als auch für die anderen Gastmusiker. Der finale Entscheidungsprozess war sehr langwierig und die definitiven Beiträge trafen eigentlich auch erst gegen Ende der Produktion ein. Es war ein bisschen so wie ein sehr großes, komplexes Puzzle, das man sich komplett nur vorstellen kann, und man hofft alle teile treffen auch wirklich ein. Bis zu dem Moment, wo man wirklich alle Teile vorliegen hat, und das Puzzle komplettieren kann. Was die Teilnahme von YMO angeht, so hatte ich für alle drei verschiedene Möglichkeiten offen gelassen, und sie entschieden sich für die Art von Beitrag, die ihnen am meisten zusagte. Haruomi Hosono entschied sich für Backing Vocals auf “The Madmen”, Yukihiro Takahashi für Backing Vocals auf “Limbo” und Ryuichi Sakamoto für ein Fender Rhodes-Solo auf “Yellow Magic”. Obwohl bei allen Beiträgen recht klar war, um was es sich handelte und was zu erwarten war, beeinflusste selbstverständlich der angelieferte Beitrag das finale Klangbild des Songs. Die grundlegende Interpretation der Songs wurde allerdings nicht mehr beeinflusst, denn die damit zusammenhängenden Entscheidungen wurden bereits bei der Aufnahme der Songs getroffen und waren einfach zu grundlegend um im Nachhinein noch Änderungen erfahren zu können. Die Idee, viele verschiedene Musiker auf “Yellow Fever!” einzuladen, war jedoch in der Tat eine Entscheidung die mit dem Klang und der Struktur des kompletten Albums zu tun hatte. Ich wollte, im Gegensatz zu den vorherigen Alben, einen wesentlich unhomogeneren, eklektischeren Klang und eine Methode dies zu erreichen waren die zahllosen, nicht abschätzbaren Gastbeiträge. Jeder der Beiträge änderte immer den geplanten Produktionsfluss in eine neue Richtung.
Was ist die Idee hinter dem Material für das Konzept Senor Coconut? Geht es um dekontextualisierende Adaptionen oder um die Hervorhebung bestimmter Charakterista? Wo gibt es Ähnlichkeiten in der Herangehensweise zwischen Original und Version?
US: Wie schon erwähnt, sehe ich den Überbau bei Senor Coconut eher als ein Produkt der Musik an als umgekehrt. Ich setze mich nicht vorher hin und denke mir ein Konzept aus, ein Wort, dass ich sowieso nicht sonderlich mag, sondern verschiedene ästhetische Ansätze, Arbeitmethoden und schlicht und ergreifend Musik sind die Ausgangsbedingungen, die am Ende ein Bild entstehen lassen, welches im besten Fall beim Hörer einen Eindruck hinterlässt. Von eben dem Hörer hängt es dann auch ab, ob sich der Überbau einstellt oder nicht. Senor Coconut beinhaltet dieses Phänomen, sodass man es auch ohne jegliches Konzept konsumieren kann. Das was z. B. mit und durch “El Baile Aleman” passierte und sich mit “Yellow Fever!” bereits andeutet, war keinesfalls geplant sondern ist im weitesten Sinne immer ein Experiment. Es sind unzählige musikalische, historische und kulturelle Komponenten, die unter ästhetischen, nicht unter logischen oder konzeptuellen Entscheidungen kombiniert werden. Die inhaltliche Verzerrung stellt sich erst am Ende ein und kann eigentlich nicht abgesehen oder geplant werden. Dabei stellt sich zum einen die Rekontextualisierung als interessantes Arbeitsfeld dar als auch auf anderer Ebene, das Kreieren von Popmusik. Parallelen zu YMO und vor allem den Soloalben von Haruomi Hosono gibt es auf jeden Fall. Das Thema Coverversionen war ja beispielsweise immer schon sehr stark vorhanden. Ich muss dazu anmerken, dass gerade elektronische Musik aus Japan wohl zu meinen größten Einflüssen zählt, die mein musikalisches Weltbild stark geprägt haben. Dabei ist das Wort “Sampling” das, was die Denkweise wohl am besten umschreibt. Die japanische Kultur als Sampling-Kultur. Das angstlose Einbetten von gesampleten Elementen in eine positivistische, gleichzeitig traditionsstarke und nach vorne gerichtete Kultur, geformt durch einen Künstler, der das Ganze in die perfekte Form und am besten sogar noch in ein poetisches Umfeld zu betten weiß. Bei Senor Coconut geht es im weitesten Sinne nicht nur um Sampling von musikalischen Teilchen, sondern gerade auch um das Sampling von musikalischen Kontexten und den damit verbundenen Wahrheiten. Das freie sich bewegen auf der historischen Zeitachse stellt die jeweiligen formellen und inhaltlichen Wahrheiten, also die Frage, ob zu einem gewissen Zeitpunkt etwas gut, richtig- oder falsch und schlecht war, grundlegend in Frage. Man hat es dem Konzept zu recht angelastet, sich Stilen zu bedienen, die historisch gesehen, uns schon lange fremd sind und anscheinend nichts mehr zu sagen haben. Interessanterweise sagt das niemand z. B. über Techno. Es geht mir durchaus darum, den Fortschrittsgedanken aus der ästhetischen Bewertung zu entfernen. Ist etwas gut weil es neu ist? Oder gibt es darüber hinaus etwas, was es gut macht. Ich denke, dieses Etwas müssen wir neu finden. Gerade in der Arbeit von Haruomi Hosono, der sich immer schon recht frei auf der Raum- und Zeitachse bewegte, fand ich diesen Rückbezug auf dieses Etwas beeindruckend, welches im Idealfall immer so etwas wie die reine ästhetische Absicht des Musikers ist.
Der kulturelle Transfer von vermeintlich nicht zur Koexistenz bestimmten fremden musikalischen Einflüssen, von Exotica bis hin zu Coverversionen, tritt in eurem Schaffen immer wieder auf. Was ist die Motivation hinter der Zusammenführung dieser Elemente?
US: Diese Koexistenz könnte man ja einfach mal in Frage stellen. Es setzt ja auch irgendwie, eine Art schaffende oder zumindest leitende Entität voraus. Was, wenn man postuliert dass jede Musik ursprünglich zur Koexistenz bestimmt war? Bei meiner arbeit mit Senor Coconut passiert es mir häufig, dass sich viele Fragen stellen, die gerade durch das Rekombinieren von Form und Inhalt auch viele Antworten erhalten. Die Motivation ist damit auf jeden Fall das Interesse an Antworten. Viele machen nicht unbedingt Sinn, genauso wenig wie manche der Fragen. Ein weiterer Punkt ist auch der, zu behaupten, dass es wirkliche Unterschiede oder gar Inkompatibilitäten gar nicht gibt, oder gar nicht geben kann. Allerdings geraten wir hier auf sehr metaphysischen Boden. War aber auch eine metaphysische Frage.
HH: Ich betrachte Kreativität immer als Prozess, der an der Grenze von vielen verschiedenen Feldern seinen Ausgang hat, diese aber auch überschreiten kann. Es ist genau so wie das Meer, das auf das Land trifft. Unterschiedliche Bereiche treffen aufeinander und dadurch entsteht was Neues. Dieser Vorgang interessiert mich am meisten, sowohl in Hinblick darauf, wie er Kreativität stimuliert als auch auf den daraus resultierenden musikalischen Ausdruck.
Gibt es einen Maßstab für die Einarbeitung fremder Einflüsse oder lässt das digitale Zeitalter den Aspekt der Herkunft zurück?
HH: Die Globalisierung hat die Musik standardisiert und heutzutage wird täglich ähnliche Musik in jedem Land reproduziert. Infolgedessen frage ich mich ob es überhaupt noch Sinn macht, über japanische oder nichtjapanische Einflüsse zu reden. Aber diese Standardisierung ist nicht die einzige Entwicklung die voranschreitet. Es ist eine musikalische Ethnizität entstanden, die unbewusst von einem tieferen Bereich übernommen wird, der mit Nationalismus nichts zu tun hat. Das ist dann in der Tat das Schicksal des digitalen Zeitalters.
US: Ich denke nicht, dass Eklektizismus unbedingt etwas mit Ignoranz zu tun hat. Es gibt meiner Meinung nach zwei Abstufungen beim Zitieren bestimmter kultureller Einflüsse. Sehr viel passiert in der Tat unbewusst, durch so etwas wie das Aufsaugen von musikalischen Bauteilen. Als Musiker passiert einem das fast permanent, dass man Musik hört und selbige auch so schnell meist nicht mehr vergisst. Der musikalische Sprachschatz häuft sich sozusagen von alleine an, abhängig davon, ob einem bestimmte Musik zusagt oder interessant erscheint. Auf der zweiten Ebene kann man diese Bauteile dann bewusst einsetzen, wenn es darum geht, bestimmte Bilder zu erzeugen, die mit räumlichen, zeitlichen und oder kulturellen Kontexten und Bezügen funktionieren. Bei diesem Schritt halte ich das Abmessen und Einordnen dieser Zitate und Bauteile für absolut notwendig. Zum einen denke ich, gibt es nichts Schlimmeres als unbewusst falsch konstruierte Simulationen, die aus Ignoranz oder Dummheit geschaffen werden. Hollywood ist dafür ein gutes Beispiel, denn hier muss häufig um ein erfolgreiches Produkt schaffen zu können der Ignoranz der masse Rechnung getragen werden. Hier kommen dann unter Umständen Stereotypen zum tragen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Bei Exotica passiert etwas Ähnliches, wobei hier jedoch nicht Ignoranz, sondern bewusstes Hantieren mit diesen Stereotypen vorliegt. Exotica erzeugt Eindrücke, Bilder und Emotionen anhand von erfundenen oder modifizierten kulturellen Bauteilen. Meiner Meinung nach sind es diese beiden Ansätze, der bewusste und der unbewusste, bzw. deren Mischung, die die Klasse eines Kunstwerks ausmachen. Die Frage nach dem Aspekt der Herkunft halte ich für extrem spannend. Es fiel mir während der Produktion zu “Yellow Fever!” auf, dass es doch einige Parallelen zwischen japanischer und deutscher Kultur gibt. wenn man einmal kurz die doch sehr drastischen Unterschiede beider Länder außer acht lässt. Mir fiel dabei zunächst auf, dass beide Länder besetzte Länder sind. Länder, in denen über mehr als 50 Jahre hinweg weitestgehend angloamerikanische Kultur etabliert wurde. Dieser Einfluss ist sowohl in Japan als auch Deutschland noch immer extrem dominant. Dieser Zustand an sich, denke ich, erzeugte in beiden Kulturen vornehmlich ein Identitätsvakuum. Das Adaptieren und Suchen nach Input von außen, der uns von der Suche nach dem Input von innen befreit, liegt beiden Nationen nahe und begann in Japan und Deutschland gleichzeitig, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Gegensatz zu dem immer noch sehr traditionell denkenden Japan, hat man Deutschland jedoch den Rückgriff auf die eigene Vergangenheit sehr schwer gemacht, vielleicht deshalb sucht man als Deutscher die Vergangenheit bevorzugt in anderen Kulturräumen. Obgleich das vielleicht unlogisch klingen mag, hat Senor Coconut sehr viel mit deutscher Identität zu tun. Das mag seltsam klingen, aber ich halte es für ein typisch deutsches Projekt.
Wie sind Humor oder auch “Novelty” in eurer Musik platziert? YMO haben bewusst Sketch-Einspieler benutzt und Senor Coconut wurde ja auch teilweise als ironisch aufgefasst. Spielt man da mit Missverständnissen?
US: Bei der Erfindung einer fiktiven Person spielen so ziemlich alle Komponenten eine Rolle, die sich in Musik kodieren lassen oder sich in Musik widerspiegeln. Dazu zählt manchmal auch Humor in allen seinen Varianten.
HH: Die Moleküle von Musik sind humorvoll, im Sinne von Lebhaftigkeit und Aktivität. Es geht nicht nur darum komisch zu sein. Auch in trauriger Musik kann man ein Element der Fröhlichkeit spüren, dass ist das Prinzip des Humors.
Wie würdet ihr euch den weiteren Verlauf eurer Karrieren wünschen? Gibt es unerreichte Ziele, die ihr noch verwirklichen wollt?
HH: Man wird älter solange man lebt. Das ist der einzige Fortschritt. In meinem Fall habe ich mehr Vergangenheit hinter mir, als ich Zukunft vor mir habe. Doch obwohl ich altere, habe ich nicht weniger vor. Ich lerne auch noch immer mehr über Musik. Ich konnte mir bloß früher nicht vorstellen, wieviel Spaß es machen würde.
US: Rückblickend kann man leider immer nur feststellen, dass die interessantesten Momente immer die waren, in denen Dinge passierten, die nicht geplant waren. Es gibt so etwas wie innere Tendenzen und Interessen, die einen dorthin leiten. Diese Tendenzen kann man nähren oder zerstören. Mehr Einwirkung kann man meiner Meinung nach auf das, was du Karriere nennst, selten ausüben, was aber für mich auch absolut den Reiz ausmacht. “Der Weg ist das Ziel” klingt vielleicht etwas sehr abgegriffen…obwohl…nicht viel abgegriffener als “chachacha”…
De:bug 06/06

Posted: May 9th, 2006 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: de:bug, Discogs | No Comments »

Am Anfang von Discogs vor sechs Jahren stand die Plattensammlung. Erst die vom Gründer Kevin Lewandowski und wenig später die anderer Websuchender, die bei der Recherche auf ausbaufähige Discographien stießen und der freundlichen Aufforderung nach Support des Archivs nachkamen. Man kann sich noch vage dran erinnern. Ich stolperte ebenfalls hier und da über die Seite, fand ein wenig Information, fand aber auch das Konzept etwas kryptisch. Dennoch fiel schon in dieser ersten Entwicklungsphase auf, dass bei jedem Besuch mehr Informationen verfügbar waren. Alternativ gab es für elektronische Musik noch eine Seite namens Amazing Discographies, bei der schon vor Discogs ziemlich viele Labels katalogisiert waren. Diese Seite ist allerdings längst verschieden, da man dort nicht die simple aber höchst effektive Idee mit dem Crosslink hatte und die einzelnen Releases keine Tracklist bereithielten. Als ich mich, durch Fälle von Beschaffungskriminalität in meinem Dunstkreis und das hölzerne Treppenhaus vor meiner Wohnungstür gemahnt, wenig später zur Katalogisierung meiner Sammlung entschloss, war alles schon gut gediehen, aber je nach Standpunkt angesichts des Zeitaufwandes musste bzw. konnte man noch viel beitragen. Gleichzeitig wurde schnell dem Komplettismus die Tür angelweit aufgestoßen und wahre Abgründe verpasster und ungeahnter Veröffentlichungen offenbarten sich praktisch zugreifbar selbst dem emsigsten Musikkonsumenten. So mancher Vielproduzent konnte sich vermutlich nur so an das eigene Schaffen erinnern, ausstehende Tantiemen inklusive. Bald war der namentliche Eintrag in punkto Google-Hit ein Ritterschlag und bald hatte Discogs den Ruf vom Hort nerdiger Otakus weg, deren eifrige Archivarbeit man mehr oder weniger belächelnd mit einem Bookmark versah. Als reines Tool für Nichtmitglieder ist die Seite jedoch auch weiterhin effektiv, was der offensichtliche globale Dauerbetrieb als führendes Referenzsystem in Plattenläden, Redaktionen und Spezialistenforen belegt.
Neben der passiven und aktiven Nutzung der Database gibt es jedoch auch andere Facetten meist personalisierter Art, die mit flotter Eigendynamik die Entwicklung der Seite zum monopolistischen Leviathan beschleunigt haben. Zum einen gibt es die Profile, über die man sich frei nach Gusto selbst präsentieren kann. Man gewährt abhängig vom eigenen Sendungsbewusstsein optional Einblick in die Plattensammlung oder Wantslist, Links und natürlich auch jeden nur denkbaren anderen Unfug. Zum anderen die Foren, wie üblich bei Discogs spartanisch und funktional im Look, jedoch von der Vielfalt der verhandelten Themen ein komplexer Mikrokosmos internationaler Perspektiven. Beide Bereiche sind die Grundpfeiler einer beachtlichen Community, ohne deren Idealismus und Enthusiasmus für das Medium Musik die ganze Sache kaum funktionieren würde. Das übergreifende Stichwort hierbei ist Kommunikation. Über die Profile finden bereits Geschmack- und Geistesverwandtschaften sowie Kauf- und Promotionsintentionen zusammen, in den Foren kann das im Austausch noch ausgebaut werden. So entstehen über einen längeren Zeitraum regelmäßiger Nutzung nationale wie internationale Kontakte und Netzwerke über Interessensgebiete, bei denen die Grenzen des rein virtuellen Umgangs längst überschritten sind. Man lernt über Discogs Leute in eigenen oder anderen Städten kennen und es entwickelt sich mit steigender Tendenz eine Art von Tourismus über die Landesgrenzen hinaus, alles auf der gemeinsamen Basis der Seite. Daneben hat sich seit 2003 der Community-Aspekt stark verändert. Bis dahin gab es nur wenige übergreifende Rubriken in den Foren, in denen von Useability-Frust, Anti-Trance-Debatten und Golfkriegsanalysen bis hin zu Lieblingsplatten und surrealem Nonsens alles und nichts dezidiert und meistens ziemlich harsch verhandelt wurde. Ursprünglich eher als Kommunikationsanhängsel anzusehen, entstand eine subversiv-unterhaltsame Seifenoper, welche den eigentlichen Zweck des Archivierens zuweilen überlagerte. Die Seite wurde somit auch für Mitglieder interessant, die bloß den Zeitvertreib suchten und die Community wuchs folglich auch abseits der Archivarbeit.
Es war abzusehen, dass der Fokus auf elektronische Musik und die Verwaltung der Seite angesichts des rasanten Wachstums das Potential nicht ausschöpfen konnten. Zunächst wurden die ächzenden Server durch bezahlte erweiterte Accounts mit Extras sowie Werbebanner verstärkt und der mit dem Betriebscode schon gut ausgelastete Inhaber engagierte einen Site-Manager für alle anderen Teilbereiche. Die Foren wurden jetzt ebenfalls moderiert und in unübersichtliche thematische Miniaturformate atomisiert, alles zur Vorbereitung einer Konsolidisierung von Discogs, welche schließlich darin mündete, dass in relativ kurzen Intervallen großmaschig andere Genres hinzugefügt wurden. Demzufolge wird Discogs in absehbarer Zeit das gesamte Spektrum von Musik abdecken können.
Es ist schwer abzusehen, wo Discogs bei dieser Wachstumsrate in Zukunft stehen wird. Einer Kommerzialisierung, die ungebremst über die Unterhaltung der Server hinausgeht, steht eine Community entgegen, die in vielen Fällen langjährige Mitglieder aufweist, welche die zahlreichen Metamorphosen der Seite sensibel bis misstrauisch beobachten. Das ist sicherlich auch darin begründet, dass bis auf den Inhaber und einen Site Manager niemand von Discogs ein Gehalt bezieht. Moderatoren und aktiven Mitgliedern bleiben so nur das Wissen um den Erfolg und Nutzwert eines kollektiven Unterfangens und die Unmengen von Tonträgern, die vor der Vergessenheit bewahrt werden konnten. Wer drohnengleich viel Freizeit für den Input und dessen Verwaltung opfert, möchte natürlich nicht auch noch dafür zur Kasse gebeten werden. Es gibt zwar die offizielle Ankündigung, Discogs nach dem Vorbild von Wikipedia zu Open Source zu machen, was jedoch aus Sorge über Nutzung der Daten durch Spam-Sites auf unbestimmte Zukunft verschoben wurde. Ein gewisser Argwohn gegenüber den Motiven des Managements wird auch dadurch hervorgerufen, dass die Seite sich zwar durch die freiwillige Mitarbeit auf User-Ebene weiterentwickelt, dieselben User aber bei Entscheidungen bezüglich der Funktionsweise kaum einbezogen werden. So werden zwar alle zukunftsträchtigen Entscheidungen in Threads detailliert abgewogen, die Argumente dieser Diskussionen haben aber zumeist nur wenig Einfluss bei der tatsächlichen Realisation. Infolgedessen klaffen der Anspruch genreübergreifender Benutzbarkeit und die Wirklichkeit genrespezifischer Archivierung oft auseinander.
Die Erfolgsgeschichte Discogs zeigt auf jeden Fall, dass der Spaß am Prinzip weit über den bloßen Sammlerinstinkt oder die Faszination akribischer Informationsverwaltung hinausgeht. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man in Kooperation mit der Musikindustrie der reinen Information die entsprechende Audiodatei als Preview-Clip bzw. bezahlten Download zur Seite stellt. Eine beträchtliche potentielle Konsumentenschar ist über den Prozess der Mitarbeit bereits mit der Plattform identifiziert und die Palette potentieller Erwerbungen erweitert sich durch die Nutzung des Archivs stetig. Da fehlt dann eigentlich nur noch die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die Musik zur Vervollständigung eines neuen Massenmediums per Computer, das ohne Läden und Vertriebe auskommt. Für antiquarische Tonträger nichtgewerblicher Anbieter bleibt dann ja immer noch der Gebrauchtmarkt, im Ansatz als Discogs Marketplace ja schon eingeführt. Wenn Majors nicht so unbeweglich wären, kämen sie ja vielleicht auch auf die Idee, dass bei ihren unübersichtlichen Backkatalogen die Verbindung von Information und Musikdatei nicht völlig abwegig ist. Statistiken über regelmäßige Ebay-Nutzer im Bereich elektronischer Musik, also dem von Discogs am besten erschlossenen Bereich, könnten da sicherlich interessante Erkenntnisse über die Beziehung von Archiv und Konsum liefern, auch wenn es dort noch um herkömmliche Tonträger geht. Und wenn man schon gerade spekuliert, eventuell würde die Kommunikation mit anderen Konsumenten über eine Archivplattform auch dazu führen, dass man über User-Rating und Vorhören schneller erfährt, dass eine angepeilte Erwerbung im Vergleich zu einer „besseren“ Alternative zu vernachlässigen ist. Die Plattenfirmen könnten sich angesichts dieser virilen Selbstverwaltung ihrer Zielgruppen teure Marketingfeldzüge sparen und müssten sich dem Qualitätsdiktat der Erfahrungswerte an der Basis beugen und das Mittelmaß wäre bald besiegt.
Realistischer ist aber wohl vielmehr, dass Discogs, in Zukunft ungleich größer und multistilistisch, auf wahnwitzig umfassende, bedingt kostenpflichtige Dokumentation beschränkt bleibt und Anbieter nur noch sicherer ablesen können, wie hoch man die Schmerzgrenze für seltene Artefakte ansetzen muss. Die Musikindustrie wird weiter Geld verbrennen und das Mittelmaß lacht sowieso immer zuletzt.
De:Bug 05/06

Posted: August 9th, 2005 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: de:bug, DJ Minx, Interview | No Comments »

Was war der Ausgangspunkt für die Enstscheidung in der Detroiter Musikszene aktiv zu werden?
Der Entschluss DJ zu werden war von meinem grundsätzlichen Interesse an Musik bestimmt, in allen Facetten. Ich begann mich für elektronische Musik zu interessieren aufgrund stilistischer Merkmale und vor allem wegen der Art, wie diese Musik die Leute berührt hat. Wo sonst bekommt man schon eine solche Bandbreite an Genres, alle zusammengefasst in einem Groove mit derartig viel Schwung? Platten wie Mr. Vs ‘I Got Rhythm’ oder Mike 303s ‘St. Sylvestre’ bleiben wohl ein Leben lang in meiner Kiste.
Du hast diverse Radiosendungen gemacht, unter anderem das weithin bekannte Format Deep Space Radio. Was für Kontakte und Einflüsse kommen aus diesem Zeitraum?
Kevin Saunderson war ein maßgeblicher Einfluss. Er hat mich immer unterstützt, zuerst gefiel ihm meine Radio-Stimme, dann respektierte er auch meine ganzen sonstigen Aktivitäten. Wenn Leute aus anderen Ländern Detroit einen Besuch abstatteten, brachten Derrick May und Juan Atkins die Zeit auf, sie für ein Treffen mit mir ins Studio zu bringen. Read the rest of this entry »
Posted: May 9th, 2005 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: de:bug, Interview, Larry Heard | No Comments »

Die Loosefingers EP tauchte in vielen Playlists vor allem wegen der beiden Acid-Tracks auf, die gerade gut in die gegenwärtigen Adaptionen des frühen Chicago-Sounds passen. War es Absicht, diesen als Reflektion deines Stils das ruhige Stück „When Summer Comes“ gegenüber zu stellen?
Ja. Das ist ein Stück, was eher auf lange Sicht angelegt ist. Das die Leute auch noch in Jahren hören und darüber nachdenken. Die Acid-Tracks sind da schon vordergründiger, aber ebenso wichtig. Mir macht das schon noch Spaß, mit Acid herumzuprobieren. Ich bin nach wie vor abenteuerlustig. Neulich habe ich mit einem Sänger herumgejammt, das klang wie ein bisschen wie Mick Hucknall oder Bono mit Acid-Sounds (lacht.). Über die Jahre hat sich einiges in diese Richtung angesammelt.
Es gibt also noch reichlich Reserven.
Ich habe hunderte derartiger Tracks gemacht. Es ist auch geplant, ähnliches Material als Loosefingers Album heraus zu bringen, welches dann auf Alleviated erscheinen soll. Read the rest of this entry »
Posted: November 9th, 1999 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: Interview, Kieler Nachrichten, Miss Kittin | No Comments »

Wie bringst Du Unterhaltung ins Djing?
Ich langweile mich nie. Ich wechsle die Atmosphäre, spiele unerwartete Melodien und riskiere etwas.
Spielst Du Freestyle? Wie machst Du das?
Ja, ich spiele Freestyle. Nur einen Sound zu spielen ist öde und außerdem mag ich verschiedene Stilarten. Zum größten Teil benutze ich Minimal Techno gemischt mit Electro, House, Breakbeats und Anderem. Freestyle ist aber gefährlich, denn es muß harmonisch sein.
Ist Retro notwendig?
Nein, ist es nicht. Daß ist geschmacksabhängig oder man will sich damit an schöne Momente erinnern. Ich bin retro zum Spaß oder um zu überraschen, aber nicht automatisch. Read the rest of this entry »
Posted: October 9th, 1999 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: Hans Nieswandt, Interview, Kieler Nachrichten | No Comments »

Leider noch zu selten verirren sich DJs mit nationalem oder gar internationalem Renommée in das etwas behütete Kieler Nachtleben. Dennoch gibt es in unregelmäßigen Abständen dann doch solche Abende, bei denen ein weltgewandter Profi-Plattenaufleger mit Erfahrung und hier noch nie erlebter Musik das Partyvolk bis zur freudigen Erschöpfung durch die Gegend scheucht. Ein gutes Beispiel für solch einen Vertreter der Zunft ist Hans Nieswandt, der vor gut zwei Jahren einen umjubelten Auftritt in der Tanzdiele absolvierte. Seitdem hat sich natürlich viel getan, aber Nieswandt ist noch immer viel beschäftigt. Sporadisch veröffentlicht er noch Artikel bei seiner alten beruflichen Heimat, der „Spex“, und will dem Schreiben auch weiterhin treu bleiben, aber hauptsächlich ist er in Bezug auf Musik von der Theorie auf die Praxis umgewechselt und ist als DJ und vor allem als Musiker bei Whirlpool Productions erfolgreich. Für kurze Zeit war er sogar Popstar, als „From Disco to Disco“ für alle Beteiligten überraschend die italienischen Charts anführte:“ Das war schon eine seltsame Episode. Es gibt in Italien eigentlich keine seriöse Musikpresse und die zuständigen Journalisten vom Feuilleton der Tageszeitungen waren immer erstaunt, daß wir gar nicht doof und eine wirkliche Band mit Hintergrund sind. Wir wurden sonst immer eher als die drei Besoffskis aus Deutschland präsentiert, so wie Trio oder so.“ Read the rest of this entry »
Posted: June 9th, 1999 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: Interview, Kieler Nachrichten, Robert Merdzo | No Comments »

Robert Merdzo aus München veröffentlicht seit 1989 elektronische Musik experimenteller Natur und hat in seinem musikalischen Lebenslauf einiges vorzuweisen. Er brachte auf dem Sub Up Label viel beachtete Klangarbeiten mit Theaterverbindung und Industrial-Flair heraus und arbeitet als Mitglied von Mass auch im herkömmlichen Bandkontext. Am auffälligsten war bisher jedoch seine Kooperation mit dem legendären Aktionstheater La Fura Dels Baus, für die er als musikalischer Direktor fungiert. Somit zeichnet er verantwortlich für die imposanten Klanggebilde der „Simbiosis“-Tour der Spanier, die ja auch bei ihrem letztjährigen Gastspiel zur Kieler Woche Aufsehen erregten. Sicherlich sorgt die Resonanz auf seine Theatermusik für ausreichend Genugtuung und Weltgewandtheit („Zuletzt sind wir in Buenos Aires vor etwa 40000 Menschen aufgetreten“), aber Robert Merdzo führt seine Talente auch gern im kleinen Rahmen vor. „ Ein Auftritt vor 20 bis 30 Menschen kann ebenso interessant sein“. Anlaß dieser Auftritte im Rahmen einer Tour durch deutsche Clubs ist seine aktuelle CD „n.a.q.o.b.“, die auf dem Münchener Traditionslabel Disko B erschienen ist. Darauf arbeitet sich Merdzo samt Partner Bülent Kullukcu auf 140 Minuten Länge durch alle denkbaren elektronischen Musiksparten und pendelt gekonnt zwischen Experiment und Tanzfläche. Zwischen Kulturbetrieb und Partykultur sieht er dabei keinen Widerspruch:“ Überhaupt nicht. Die Leute reagieren sehr aufgeschlossen auf Brüche zwischen tanzbarer Musik und Ambientstücken. Die erforderliche Improvisation und die Grenzüberschreitungen machen das Ganze gerade reizvoll. Das Publikum ist im positiven Sinne hin- und hergerissen “. Auf jeden Fall ist Merdzo durchaus imstande, sowohl Tanzfreudige als auch bloße Zuhörer zu begeistern. Sein Auftritt in der Tanzdiele geht jedenfalls über eine getreue CD-Präsentation hinaus. „ Wir sind ein elektronischer Live Act, der autark ist. Wir kommen und stöpseln uns ein. Die Anzahl der Geräte orientiert sich an den Räumlichkeiten der Clubs. Wir spielen auch nicht nur die letzte CD herunter. Wir benutzen etwa fünf Tracks davon und benutzen auch altes oder neues, noch unveröffentlichtes Material. Die Auftritte sind jeweils unterschiedlich. Wir improvisieren viel und benutzen die Tracks als Basics, die wir dann live remixen. Zum Beispiel kommen durch Bülent orientalische und andere Einflüsse dazu und ich spiele auch Bass und setze meine Stimme ein.“ Mit diesem offenen und funktionstüchtigen Konzept müssen sich Merdzo und Kullukcu nicht unbedingt an einem DJ orientieren aber sie haben dennoch einen kongenialen Mitstreiter dabei, auf den sich die hiesige Technoszene ebenfalls freuen kann. DJ Upstart dürfte als Disko B Chef, Ultraschall Resident, Technopionier und Mitstreiter von DJ Hell ebenso weit über München hinaus bekannt sein und wird am gleichen Abend die Plattenteller bedienen.
Kieler Nachrichten 06/99

Posted: March 9th, 1999 | Author: Finn | Filed under: Artikel | Tags: DJ Subtropic, Elektropasha, Kieler Nachrichten, Ralf Köster, Superdefekt | No Comments »

Der ebenfalls von TFSM/MFOC präsentierte Auftritt von Bradley Strider im Januar ist in Kiel wohl in guter Erinnerung geblieben, denn die Tanzdiele war am Samstag gut besucht, als Super Defekt, Elektropasha und DJ Subtropic im Rahmen der Plattenbau-Tour die Plattenspieler bedienten. Die rege Neugier der Kieler wurde dann auch reichhaltig belohnt, denn die drei DJs lieferten einen facettenreichen Abend in Sachen anspruchsvoller elektronischer Musik. Super Defekt und Elektropasha starteten eine Aufwärmphase auf hohem Niveau, die stilistisch von englischen Produktionen der 90er Ära geprägt war, als Labels wie Rephlex oder Warp das etwas unglückliche Genre „Intelligent Techno“ begründeten. Gut zusammengemixt gab es Musik in der Art von Richard D. James, B12, Kirk Degiorgio oder Autechre, also den musikalischen Gegenentwurf zu gleichförmigen Technosets, die sich eher über Härte und Geschwindigkeit als über Ideenvielfalt und Mut zum Risiko definieren. Am Anfang des Abends schien das Publikum damit etwas überfordert zu sein und nur zögerlich traute man sich zu, sich zu bewegen. Die DJs zogen daraus die Konsequenz und schwenkten flexibel von den ungeraden und zerhackten Beats britischer „Artificial Intelligence“ zu aktuellem Electro und tiefem Technohouse a la Planet E und Baby Ford. Infolgedessen regte sich nun die Partylaune und so entstand der notwendige Nährboden für Jake Smith alias DJ Subtropic aus Brighton, dessen Plattenauswahl aber zuerst kaum an subtropische Gefilde denken ließ. Düstere Science-Fiction Filme lagen als Assoziation schon etwas näher, da er seinen Set mit ziemlich hartem Darkstep begann und konsequent knackigen Drum and Bass mit Boller-Baß und sägenden Synthies auflegte. Da wurde einem ordentlich der Kopf gewaschen und es kam Bewegung in die Anwesenden. Dankenswerterweise verzichtete Subtropic auf übermäßige Tempomachererei, so daß auch Drum and Bass-Unkundige zu dem dunklen Soundgewitter tanzen konnten. Als sich dann schon jeder auf eine wuchtige Breakbeat-Party eingestellt hatte, wechselte Subtropic gekonnt das Register und schwenkte zu einem kompetenten Freestyle-Set über, welches in punkto Mixfertigkeit und Zusammenstellung einiges zu bieten hatte. Er überrumpelte die aufnahmebereiten Zuhörer mit Sprüngen zwischen Hip Hop, Electro, Filter Disco, House und Downtempo Breakbeats und immer wieder zurück zu Drum and Bass. Glücklicherweise war an diesem Abend jeder in der Laune für Abwechslung und Experimentierfreude, denn der Bereich um den DJ war durchgehend prall gefüllt. Nach DJ Subtropic sorgte dann Labelmacher Ralf Köster selbst mit ausgesuchten House- und Technoperlen für den runden Abschluß einer gelungenen Nacht. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Tanzdiele auch weiterhin mit ihm zusammenarbeiten kann, denn Veranstaltungen von diesem Kaliber kann das Kieler Nachtleben wahrlich gut gebrauchen.
Kieler Nachrichten 03/99


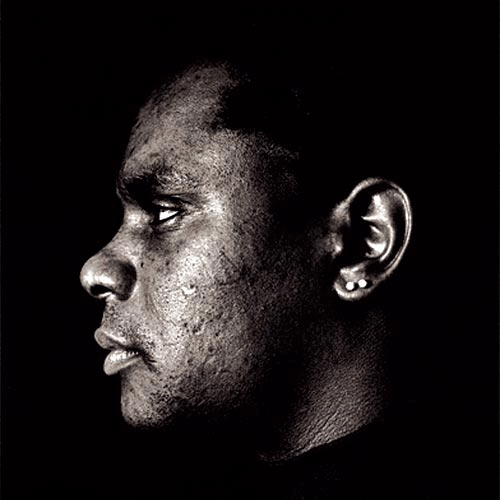









Recent Comments